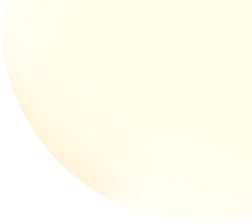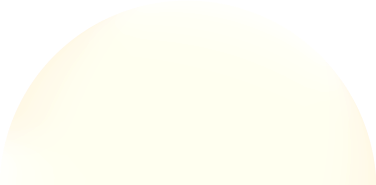Hormonstörungen kommen häufiger vor als gedacht und können sowohl die Fruchtbarkeit als auch die Psyche beeinflussen.
Alles Wichtige zu Hormonstörungen bei Frauen
- Hormonstörungen sind häufig und betreffen Frauen in verschiedenen Lebensphasen, z. B. Pubertät, Schwangerschaft und Wechseljahre.
- Einer der häufigsten hormonellen Störungen bei Frauen ist das PCO-Syndrom.
- Auch Stimmungsschwankungen und psychische Symptome können durch hormonelle Veränderungen auftreten.
- Gewichtszunahme oder -verlust sind oft mit Schilddrüsenproblemen oder Insulinresistenz verbunden.
- Bluttests und Ultraschall können Hormonstörungen identifizieren.
Hormonstörungen sind nicht selten
Der Hormonhaushalt einer Frau ist ein fein abgestimmtes System – und bereits kleine Veränderungen können spürbare Auswirkungen auf Körper und Psyche haben. Hormonstörungen sind deshalb keine Seltenheit, besonders im gebärfähigen Alter, während der Wechseljahre oder im Zusammenhang mit Erkrankungen wie dem PCO-Syndrom. Doch woran erkennt man eine hormonelle Störung überhaupt?
Was sind Hormonstörungen?
Hormonstörungen – auch als hormonelle Dysbalancen oder hormonelles Ungleichgewicht bezeichnet – entstehen, wenn der Körper zu viele oder zu wenige Hormone produziert. Besonders betroffen sind dabei die bekanntesten Hormone: Geschlechtshormone wie Östrogen, Progesteron, aber auch Testosteron, sowie Schilddrüsenhormone und Stresshormone wie Cortisol.
Die Ursachen reichen von Schilddrüsenerkrankungen über Erkrankungen der Eierstöcke oder Nebennieren bis hin zu starken Hormonschwankungen durch bestimmte Lebensphasen wie Pubertät, Schwangerschaft oder Menopause. Auch die Einnahme oder das Absetzen bestimmter Medikamente – etwa antihormonellen Medikamenten – kann den weiblichen Zyklus beeinflussen.

Typische Symptome einer Hormonstörung
Hormonstörungen äussern sich bei betroffenen Frauen sehr unterschiedlich. Die folgenden verschiedenen Symptome treten besonders häufig auf:
Zyklusstörungen und Probleme mit der Regelblutung
Unregelmässige Menstruationszyklen, Zwischenblutungen, ein ausbleibender Eisprung oder Schmerzen bei der Regelblutung sind oft Anzeichen für hormonelle Probleme. Besonders junge Frauen mit PCO-Syndrom zeigen häufig keinen normalen Zyklus. Hier kommt es durch eine chronische Stimulation der Eierstöcke zur Bildung vieler kleiner Follikel, aber ohne Eisprung – was zu Unfruchtbarkeit führen und den Kinderwunsch erschweren kann.
Stimmungsschwankungen und emotionale Symptome
Plötzliche Stimmungsschwankungen, Verstimmungen, Reizbarkeit oder depressive Phasen – all das kann auf hormonelle Veränderungen hinweisen, etwa im Rahmen des Prämenstruellen Syndroms (PMS) oder der Wechseljahre. Studien zeigen, dass hormonelle Schwankungen, insbesondere der Abfall von Östrogen, das Risiko für psychische Erkrankungen bei erkrankten Frauen deutlich erhöhen können.

Hitzewallungen und Schweissausbrüche
Typisch für die Hormonumstellung bei Frauen in den Wechseljahren sind Hitzewallungen, Schweissausbrüche und Schlafprobleme. Ursache ist häufig der sinkende Östrogenspiegel, der auch weitere hormonelle Veränderungen im Körper auslösen kann.
Libidoverlust
Ein Ungleichgewicht der Sexualhormone wie Progesteron oder Östrogen kann die Lust auf Sex verringern. Häufige Begleiterscheinungen sind vaginale Trockenheit oder Schmerzen beim Geschlechtsverkehr (Dyspareunie).
Stoffwechselveränderungen
Hormonstörungen betreffen auch den Stoffwechsel. Eine Schilddrüsenunterfunktion, oft durch Hashimoto-Thyreoiditis, führt zu Gewichtszunahme, Müdigkeit, Konzentrationsproblemen und Depressionen. Umgekehrt kann eine Überfunktion zu ungewolltem Gewichtsverlust führen. Auch Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse, wie Diabetes mellitus, der eng mit dem Insulinhaushalt zusammenhängt, zählen zu den hormonellen Erkrankungen und kann in Zusammenhang mit dem PCO-Syndrom auftreten.
Haarausfall, Akne und Hautprobleme
Ein erhöhter Anteil an männlichen Hormonen (Androgenen) kann bei Frauen zu Haarausfall, Akne oder verstärkter Körperbehaarung führen. Besonders bei PCOS ist dies ein häufiges Symptom – verursacht durch einen unausgeglichenen Hormonspiegel.

Psychische Symptome durch Hormonfluktuationen
Frauen sind überdurchschnittlich häufig von Depressionen und Angststörungen betroffen. Studien zeigen eine Lebenszeitprävalenz von bis zu 33.7 % für Angststörungen und 20.6 % für depressive Erkrankungen.
Östrogen und Progesteron, die zentralen weiblichen Sexualhormone, wirken nicht nur auf die Eierstöcke und den Menstruationszyklus, sondern haben auch eine starke Wirkung auf das Gehirn. Sie beeinflussen Stimmung, Gedächtnis, Stressverarbeitung und sogar die Schmerzwahrnehmung.
Hier erklärt Dr. med. Konstantin Wagner wie Depressionen bei Frauen und Hormone zusammenhängen:
Knochenschwund (Osteoporose)
Ein dauerhaft niedriger Östrogenspiegel kann langfristig zu Osteoporose führen – vor allem nach der Menopause. Hier kann eine Hormontherapie mit bioidentischen Hormonen helfen, den Knochenabbau zu verlangsamen. Studien betonen den Nutzen von bioidentischen Hormonen, wenn sie gezielt und unter ärztlicher Kontrolle eingesetzt werden.
Dazu sagt Dr. Anneliese Schwenkhagen, Gynäkologin im Vorstand der deutschen Menopause Gesellschaft:
Dabei handelt es sich um Hormone, deren Struktur den Hormonen entspricht, die der weibliche Körper selbst bildet.
Ursachen hormoneller Störungen
Neben genetischen Faktoren und Lebensphasen (z. B. Stillzeit oder Wechseljahre) gehören zu den häufigsten Ursachen:
- PCO-Syndrom
- Schilddrüsenerkrankungen (z. B. Hashimoto)
- Störungen der Nebennieren und Eierstöcke
- Tumore in Hypophyse oder Hypothalamus
- bestimmte Medikamente, darunter auch antihormonelle Medikamente
- starke Stressbelastung mit erhöhter Produktion von Stresshormonen
- Absetzen hormoneller Verhütung (z. B. Antibabypille)

Diagnostik von Hormonstörungen: Was sollte abgeklärt werden?
Bei länger anhaltenden Beschwerden wie Zyklusstörungen, Haarausfall, Akne oder Stimmungstiefs empfiehlt sich der Gang zur Gynäkologin oder einer spezialisierten Fachärztin für gynäkologische Endokrinologie. Entscheidend ist eine umfassende Diagnostik, um die Ursache des hormonellen Ungleichgewichts zu identifizieren.
Entscheidend ist eine umfassende medizinische Abklärung, die neben einem ärztlichen Gespräch auch eine körperliche Untersuchung umfasst. Nur so lässt sich die Ursache des hormonellen Ungleichgewichts zuverlässig feststellen und eine individuell angepasste Therapie einleiten.
Im Rahmen einer Hormondiagnostik werden je nach Symptomatik folgende Parameter im Blut bestimmt:
- Zyklusrelevante Hormone wie FSH (Follikelstimulierendes Hormon), LH (Luteinisierendes Hormon), Östrogen, Progesteron
- Schilddrüsenwerte: TSH, fT3, fT4 – bei Verdacht auf Hashimoto zusätzlich Antikörper (TPO-AK, TG-AK)
- Androgene wie Testosteron, DHEA-S (besonders bei Verdacht auf PCOS oder Haarausfall)
- Prolaktin bei Zyklusstörungen oder Milchfluss
- Cortisol und ggf. ACTH bei chronischer Erschöpfung oder Verdacht auf Nebennierenstörung
- Je nach Verdacht werden auch Blutzuckerspiegel und Insulinwerte kontrolliert, z. B. wenn ein Zusammenhang mit Diabetes mellitus oder PCOS vermutet wird.
Auch ein Zyklusmonitoring sowie eine Ultraschalluntersuchungen der Eierstöcke können zur Diagnostik beitragen. Bei Verdacht auf ein hormonaktives Adenom kann zudem eine regelmässige Gesichtsfelduntersuchung erforderlich sein. Je nach individueller Situation werden die Werte ergänzt, um die Therapie optimal anzupassen.

Behandlungsmöglichkeiten und Therapien
Nach einer umfassenden Diagnostik folgt der nächste wichtige Schritt: die richtige Therapie. Da Hormonstörungen sehr unterschiedliche Ursachen haben können, ist eine individuell angepasste Behandlung entscheidend. Sie richtet sich immer nach den Ergebnissen der medizinischen Abklärung, den persönlichen Beschwerden – und nicht zuletzt auch danach, ob ein Kinderwunsch besteht.
1. Medikamentöse Behandlung
Viele Hormonstörungen lassen sich mit Medikamenten gezielt behandeln. Beispiele sind:
- Hormontherapie bei Zyklusstörungen, um den Eisprung wiederherzustellen und die Chancen auf eine Schwangerschaft zu erhöhen
- Hormonelle Kontrazeptiva wie die Anti-Baby-Pille, die einerseits den Zyklus regulieren, andererseits aber bei Kinderwunsch abgesetzt werden müssen – oft wird danach erst eine verborgene Störung sichtbar
- Dopaminagonisten bei erhöhter Prolaktinproduktion oder einem hormonproduzierenden Tumor wie dem Prolaktinom, das auch in der Schwangerschaft eine Rolle spielen kann
- Hormonersatztherapie mit bioidentischen Hormonen, z. B. in den Wechseljahren, wenn Frauen trotz Kinderwunsch eine stabile hormonelle Basis benötigen
2. Lebensstil und unterstützende Massnahmen
Ein gesunder Lebensstil unterstützt die Fruchtbarkeit und verbessert oft die Wirkung medizinischer Therapien:
- gezielte Ernährungsberatung, die den Stoffwechsel stabilisiert, den Blutzuckerspiegel reguliert und die Eizellqualität positiv beeinflussen kann
- regelmässige Bewegung, die den Hormonhaushalt ausgleicht und das Körpergewicht optimiert – ein wichtiger Faktor für die Fruchtbarkeit
- Entspannungstechniken wie Yoga oder Meditation, die Stresshormone senken und so die Chancen auf eine Schwangerschaft verbessern können
- ausreichend Schlaf, da Schlafstörungen die hormonelle Balance und die Eizellreifung beeinträchtigen können
3. Alternative und komplementäre Methoden
Gerade bei unerfülltem Kinderwunsch greifen viele Frauen auf ganzheitliche Verfahren zurück – oft begleitend zur schulmedizinischen Therapie:
- Ansätze der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM), die bei Kinderwunschbehandlungen wie IVF oder ICSI unterstützend wirken können
- pflanzliche Präparate, die den Zyklus regulieren sollen – deren Einsatz sollte aber immer mit einer Ärztin oder einem Arzt abgestimmt werden
Hormonstörungen sind komplex – aber behandelbar
Ob es um das PCO-Syndrom, den Kinderwunsch, Zyklusstörungen oder psychische Symptome geht – entscheidend ist eine individuelle, ganzheitliche Abklärung. So kann eine gezielte Hormonbehandlung Zyklusstörungen regulieren oder die Fruchtbarkeit verbessern.
Hormonelle Veränderungen betreffen dabei nicht nur den Körper – sondern auch die Psyche. Wer unter anhaltender Erschöpfung, innerer Unruhe oder Stimmungsschwankungen leidet, sollte auch die hormonelle Ebene mitdenken. Der richtige Ansprechpartner ist hier meist der Gynäkologe oder ein Facharzt für Endokrinologie bzw. gynäkologische Endokrinologie.
Du möchtest mehr über deine Hormone erfahren? Dann besuche uns in unserer Kinderwunschklinik in Zürich. Hier untersuchen wir 25 Hormone und 50 weitere Parameter im Blut, um mögliche Ursachen für deinen unerfüllten Kinderwunsch zu finden.
FAQ zu Hormonstörungen bei Frauen und Symptomen
Wann ist eine Hormonbehandlung sinnvoll?
Eine Hormonbehandlung kann helfen, wenn Beschwerden stark sind oder wenn ein Kinderwunsch besteht. Beispiele sind Schilddrüsenhormone bei Unterfunktion, Gestagene bei Zyklusstörungen oder bioidentische Hormone in den Wechseljahren. Die Entscheidung sollte immer individuell durch eine Fachärztin für Gynäkologie oder Endokrinologie erfolgen.
Können Hormonstörungen auch Kopfschmerzen oder Migräne auslösen?
Ja. Schwankungen von Östrogen und Progesteron wirken auf Botenstoffe im Gehirn, zum Beispiel Serotonin. Dadurch können hormonelle Migräne oder Spannungskopfschmerzen entstehen, vor allem rund um die Menstruation.
Welche Rolle spielt die Ernährung bei Hormonstörungen?
Eine ausgewogene Ernährung kann den Hormonhaushalt unterstützen. Ballaststoffreiche Kost stabilisiert den Blutzuckerspiegel, Omega-3-Fettsäuren wirken entzündungshemmend und pflanzliche Eiweisse können den Stoffwechsel entlasten. Bei Übergewicht oder PCOS empfehlen Fachgesellschaften gezielte Ernährungsprogramme.