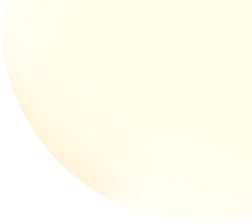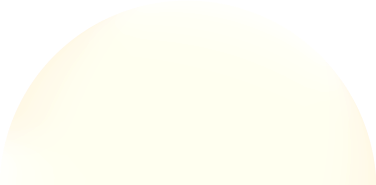Jede 4. Schwangerschaft endet in einer Fehlgeburt und doch ist es noch ein Tabuthema. Erfahre alles über das Fehlgeburt Risiko und wie du es senken kannst.
Das Wichtigste zum Fehlgeburtsrisiko:
- 25 bis 30 % aller Schwangerschaften mit einer Fehlgeburt
- Die meisten Fehlgeburten (etwa 85 %) passieren in den ersten 12 Schwangerschaftswochen
- Das Risiko steigt mit zunehmendem Alter der Frau, insbesondere ab 35 Jahren und deutlich nach 40 Jahren
- Die häufigsten Ursachen für frühe Fehlgeburten sind genetische Anomalien
- Mit Hilfe von Präimplantationsdiagnostik (PID) kann das Fehlgeburtsrisiko deutlich reduziert werden
Jede 4. Schwangerschaft endet in einer Fehlgeburt
Fehlgeburten sind nach wie vor ein grosses Tabuthema in unserer Gesellschaft. Nur wenige sprechen offen darüber, und doch ist die Realität eine andere: Schätzungen zufolge enden etwa 25 bis 30 Prozent aller Schwangerschaften mit einer Fehlgeburt.
Für betroffene Frauen und Paare ist dies ein zutiefst erschütterndes Ereignis, ganz gleich in welcher Schwangerschaftswoche es geschieht. Gerade weil so wenig über dieses Thema gesprochen wird, wissen viele nicht, wie häufig Fehlgeburten tatsächlich vorkommen.
Für Paare mit Kinderwunsch, die sich vielleicht in einer Kinderwunschbehandlung wie einer IVF oder ICSI befinden, kann die Frage nach dem eigenen Fehlgeburtsrisiko sehr präsent sein. Es ist wichtig zu wissen, dass auch bei diesen Methoden ein gewisses Risiko besteht. Glücklicherweise gibt es Möglichkeiten, dieses Risiko deutlich zu minimieren, beispielsweise durch einen genetischen Kompatibilitätstest der Eltern oder eine Präimplantationsdiagnostik.
In unserer Kinderwunschklinik wissen wir um die Sensibilität dieses Themas und möchten dir mit diesem Artikel einfühlsame Informationen und Unterstützung anbieten. Wir beleuchten die Risikofaktoren einer Fehlgeburt, sprechen über mehrfache Fehlgeburten, die Wahrscheinlichkeit einer Fehlgeburt in verschiedenen Schwangerschaftswochen und den Einfluss des Alters – sowohl der Mutter als auch des Vaters.
Ausserdem erfährst du, was bei einer Fehlgeburt passiert, welche medizinischen Möglichkeiten es gibt und wie wir dich auf deinem weiteren Weg zum Wunschkind begleiten können.
Warum wir mehr über Fehlgeburten reden sollten und warum es immer noch ein Tabuthema ist, erfährst du im Podcast mit Frau Dr. med. Nadine Al-Kaisi.
Was versteht man unter einer Fehlgeburt?
Eine Fehlgeburt, oft auch als Spontanabort bezeichnet, ist der Verlust einer Schwangerschaft vor der 20. oder 24. Schwangerschaftswoche. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) spricht von einer Fehlgeburt, wenn ein Fötus vor der 24. Woche oder mit einem Gewicht unter 500 Gramm im Mutterleib verstirbt.
Mediziner unterscheiden zwischen dem Frühabort, der in den ersten 12 Wochen eintritt, und dem Spätabort, der zwischen der 12. und 24. Woche stattfindet.
Schätzungen zufolge enden 10 bis 20 % aller im Ultraschall bestätigten Schwangerschaften so. Und manchmal passiert es sogar ganz früh, bevor eine Frau überhaupt weiss, dass sie schwanger ist – diese sehr frühen Verluste werden oft als verspätete oder starke Regelblutung wahrgenommen.
Fehlgeburt Risiko nach Schwangerschaftswoche
Das Risiko für eine Fehlgeburt ist in den ersten Wochen der Schwangerschaft am höchsten, insbesondere während der Frühschwangerschaft. Viele sehr frühe Verluste treten sogar ein, bevor eine Frau überhaupt weiss, dass sie schwanger ist. Die meisten Fehlgeburten (etwa 85 % oder vier von fünf) ereignen sich innerhalb der ersten 12 Schwangerschaftswochen.
Betrachten wir die Wahrscheinlichkeit einer Fehlgeburt nach Schwangerschaftswoche genauer:
- Um den Zeitpunkt der Einnistung (Implantation) herum kann das Risiko sehr hoch sein. Schätzungsweise nisten sich etwa 50 % aller befruchteten Eizellen nicht richtig in die Gebärmutter ein, was zu einem sehr frühen Schwangerschaftsverlust (biochemische Schwangerschaft) führt.
- In der 5. bis 6. Schwangerschaftswoche liegt die Fehlgeburtsrate bei bis zu 20 %.
- In der 8. Schwangerschaftswoche sinkt sie auf etwa 4.2 %.
- Ab der 10. Schwangerschaftswoche beträgt sie dann nur noch etwa 0.7 %.
Generell nimmt das Risiko einer Fehlgeburt mit jeder vollendeten Schwangerschaftswoche ab, insbesondere nach dem ersten Trimester. Sobald die Plazenta vollständig entwickelt ist (etwa um die 12. Woche herum), sinkt das Risiko einer Fehlgeburt deutlich.

Fehlgeburtsrisiko und das Alter der Mutter
Das Risiko einer Fehlgeburt steigt mit zunehmendem Alter der Mutter deutlich an. Die folgende Tabelle fasst die geschätzten Risiken für verschiedene Altersgruppen zusammen, basierend auf den Informationen aus verschiedenen Studien:
| Alter der Mutter (Jahre) | Geschätztes Fehlgeburtsrisiko (%) |
|---|---|
Unter 30 | 10-15 |
30-34 | 15 |
35-39 | 20-25 |
40-44 | 40-50 |
Über 45 | Über 50-90 |
Diese Zahlen machen deutlich, wie stark das Fehlgeburtsrisiko bei älteren Frauen ansteigt, besonders bei Frauen über 40 oder 45 Jahre. Der Hauptgrund dafür ist die abnehmende Qualität der Eizellen und die damit verbundene höhere Wahrscheinlichkeit von Chromosomenstörungen.
Fehlgeburtsrisiko nach IVF und ICSI
Das Fehlgeburtsrisiko nach einer Kinderwunschbehandlung ist in vielen Fällen vergleichbar mit dem einer natürlichen Empfängnis. Allerdings kann die Präimplantationsdiagnostik (PID), insbesondere die PGT-A (Präimplantationsgenetische Testung auf Aneuploidien), das Risiko für einen Fehlgeburt verringern. Eine Meta-Analyse zeigte, dass PGT-A bei Frauen mit wiederholtem Schwangerschaftsverlust zu einer signifikant niedrigeren klinischen Fehlgeburtsrate (Senkung des Risikos um 26 %) führte.
Eine weitere Analyse deutete darauf hin, dass PGT-A auch die Fehlgeburtsrate während einer IVF-Behandlung senken könnte, vor allem bei Frauen über 35 Jahren (Reduktion des Fehlgeburtsrisikos um 55 %). Darüber hinaus ergab eine Studie an Frauen ab 38 Jahren, die unter wiederholten, unerklärten Fehlgeburten litten, dass PGT-A die frühe Fehlgeburtsrate signifikant reduzierte. In dieser spezifischen Studie sank die frühe Fehlgeburtsrate von 40 % in der Kontrollgruppe auf 16.7 % in der PGT-A-Gruppe.
Welche Faktoren beeinflussen das Fehlgeburtsrisiko?
Das Risiko einer Fehlgeburt ist von bestimmten Faktoren abhängig, die wir im Folgenden genauer betrachten möchten.
Alter der Mutter
Ein wesentlicher Faktor, der das Risiko einer Fehlgeburt beeinflusst, ist das Alter der Mutter. Studien zeigen, dass mit zunehmendem Alter der Mutter die Wahrscheinlichkeit einer Fehlgeburt steigt. So liegt das Risiko für Frauen in den 20ern deutlich niedriger als für Frauen in den 30ern und 40ern.
Insbesondere Frauen über 35 Jahre und ältere Frauen haben ein erhöhtes Risiko, wobei dieses nach dem 40. und 45. Lebensjahr nochmals deutlich ansteigt. Bei Frauen über 45 Jahre kann das Fehlgeburtsrisiko sogar über 75 % betragen.
Dieser Anstieg des Risikos mit zunehmendem Alter der Mutter ist unter anderem auf die abnehmende Qualität der Eizellen und eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für genetische Ursachen zurückzuführen. Mit fortschreitendem Alter steigt die Wahrscheinlichkeit von Chromosomenstörungen wie der Aneuploidie (eine fehlerhafte Anzahl von Chromosomen) in den Eizellen.
Alter des Vaters
Neben dem Alter der Mutter spielt auch das Alter des Vaters eine Rolle beim Fehlgeburtsrisiko. Studien deuten darauf hin, dass ein höheres Alter des Vaters, insbesondere wenn sie bei der Zeugung über 45 Jahre alt waren.
Als mögliche Ursache hierfür wird die Zunahme von Schädigungen im Erbgut der Spermien mit zunehmendem Alter angesehen. Diese Schädigungen können zu einer fehlerhaften Entwicklung des Embryos führen.
Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass einige Forschungsergebnisse keinen statistisch signifikanten Einfluss des väterlichen Alters auf das Fehlgeburtsrisiko zeigen. Unabhängig davon wird ein höheres väterliches Alter auch mit anderen negativen Schwangerschaftsausgängen wie Frühgeburt und niedrigem Geburtsgewicht in Verbindung gebracht.
Genetische Ursachen
Genetische Ursachen, insbesondere Chromosomenstörungen der befruchteten Eizelle bzw. des Embryos, sind die häufigsten Ursachen für frühe Fehlgeburten. Diese Fehler in der genetischen Ausstattung entstehen oft spontan während der Befruchtung.
Häufige Beispiele hierfür sind Trisomien, bei denen ein Chromosom dreifach anstatt zweifach vorhanden ist, wie beispielsweise die Trisomie 16, 21 oder 22. Die Wahrscheinlichkeit solcher Chromosomenstörungen steigt mit zunehmendem Alter der Mutter. In einigen Fällen kann auch einer der Elternteile eine balancierte strukturelle Chromosomenveränderung tragen, was das Risiko einer Fehlgeburt erhöhen kann.
Vorerkrankungen
Bestimmte chronische Erkrankungen oder Vorerkrankungen der Mutter können das Risiko einer Fehlgeburt erhöhen. Dazu gehören:
- Autoimmunerkrankungen: Autoimmunerkrankungen wie das Antiphospholipid-Syndrom (APS), der systemische Lupus erythematodes (SLE) und die Hashimoto-Thyreoiditis können das Risiko für Fehlgeburten und wiederholte Schwangerschaftsverluste erheblich erhöhen. Sie beeinträchtigen die Einnistung des Embryos sowie die Entwicklung der Plazenta und können so den Schwangerschaftsverlauf negativ beeinflussen. Spezifische Antikörper, darunter Antiphospholipid- und Schilddrüsenantikörper, stehen in direktem Zusammenhang mit einer erhöhten Fehlgeburtsrate. Eine frühzeitige Diagnose und gezielte Behandlung sind daher essenziell, um die Chancen auf eine erfolgreiche Schwangerschaft zu verbessern.
- Schilddrüsenerkrankungen: Sowohl eine Unterfunktion als auch eine Überfunktion der Schilddrüse können das Fehlgeburtsrisiko steigern. Auch eine subklinische Hypothyreose (eine milde Form der Unterfunktion) wird mit einem erhöhten Risiko in Verbindung gebracht. Optimale Schilddrüsenhormonspiegel sind daher für eine gesunde Schwangerschaft unerlässlich.
- Hormonelle Störungen: Andere hormonelle Störungen, wie das polyzystische Ovarialsyndrom (PCOS), können ebenfalls das Risiko einer Fehlgeburt erhöhen. Ein Ungleichgewicht der Hormone, beispielsweise eine unzureichende Produktion von Progesteron, kann die gesunde Entwicklung des Embryos in der Gebärmutter erschweren.
Weitere Risikofaktoren
Neben den bereits genannten Faktoren gibt es weitere Gründe, die das Risiko einer Fehlgeburt beeinflussen können:
- Vorangegangene Fehlgeburten: Frauen, die bereits eine Fehlgeburt erlitten haben, haben ein leicht erhöhtes Risiko für eine weitere Fehlgeburt.
- Lebensstilfaktoren: Ein ungesunder Lebensstil (Rauchen, Alkoholkonsum oder Drogengebrauch) kann das Fehlgeburtsrisiko erhöhen. Auch Übergewicht (Adipositas) und Untergewicht können das Risiko beeinflussen.
- Anatomische Anomalien der Gebärmutter: Fehlbildungen der Gebärmutter wie Myome, Polypen oder ein Uterus-Septum können die Einnistung des Embryos oder sein Wachstum beeinträchtigen und somit das Risiko einer Fehlgeburt erhöhen.
- Zervixinsuffizienz: Eine Gebärmutterhalsschwäche (Zervixinsuffizienz) kann zu einer vorzeitigen Öffnung des Gebärmutterhalses führen und somit eine Fehlgeburt auslösen.
- Infektionen: Bestimmte Infektionen während der Schwangerschaft können das Fehlgeburtsrisiko erhöhen, indem sie die Gebärmutter, die Plazenta oder den sich entwickelnden Embryo direkt beeinträchtigen. Zu den risikobehafteten Infektionen gehören unter anderem Toxoplasmose, Cytomegalievirus (CMV), Röteln, Listeriose und bakterielle Vaginosen. Einige dieser Infektionen können Entzündungsreaktionen auslösen, die zu einer Fehlgeburt führen, während andere die fetale Entwicklung stören.
- Stress: Chronischer Stress kann ebenfalls ein Risikofaktor für eine Fehlgeburt sein, da er hormonelle Ungleichgewichte und Entzündungsprozesse im Körper begünstigt. Ein dauerhaft erhöhter Cortisolspiegel kann die Durchblutung der Gebärmutter beeinträchtigen, was die Einnistung des Embryos und die Entwicklung der Plazenta negativ beeinflussen kann. Zudem wird Stress mit einer verstärkten Aktivierung des Immunsystems in Verbindung gebracht, was das Risiko für Komplikationen erhöhen kann.

Wiederholte Fehlgeburten: Wenn das Risiko sich erhöht
Von wiederholten Fehlgeburten, auch habitueller Abort genannt, spricht man, wenn zwei oder mehr (nach Definition der ASRM) oder drei oder mehr (nach Definition der WHO, oft in Leitlinien verwendet) aufeinanderfolgende Fehlgeburten vor einer bestimmten Schwangerschaftswoche (meist vor der 20. oder 24. Woche) auftreten.
Wiederkehrende Fehlgeburten sind relativ selten und betreffen etwa 1 bis 3 % aller Paare im reproduktiven Alter (bei Definition von drei oder mehr Fehlgeburten). Wird die Definition von zwei oder mehr Fehlgeburten zugrunde gelegt, liegt die Häufigkeit bei etwa 5 %.
Es ist wichtig zu wissen, dass das Risiko einer weiteren Fehlgeburt nach mehrfachen Fehlgeburten ansteigt. So liegt das Risiko nach zwei vorherigen Fehlgeburten bei etwa 25 %, nach drei Fehlgeburten bei 33 bis 45 % und nach vier oder mehr Fehlgeburten sogar bei bis zu 54 %.
Die Ursachen für wiederholte Fehlgeburten können vielfältig sein und bleiben in etwa 50 bis 75 % der Fälle ungeklärt (idiopathisch).
Mögliche Ursachen umfassen genetische Faktoren (Chromosomenanalyse beider Partner, Untersuchung des Abortmaterials), anatomische Veränderungen der Gebärmutter (z.B. Uterus septum, Myome, Verwachsungen), Autoimmunerkrankungen (insbesondere das APS), endokrine Störungen (Schilddrüsenfunktionsstörungen, PCOS, Gelbkörperschwäche), Thrombophilien (erhöhte Neigung zu Blutgerinnseln) und möglicherweise auch männliche Faktoren (erhöhte Spermien-DNA-Fragmentierung).

Der Ablauf einer Fehlgeburt: Anzeichen und Diagnose
Die ersten Anzeichen einer drohenden Fehlgeburt sind oft vaginale Blutungen oder Schmierblutungen. Die Stärke der Blutung kann von leichten Schmierblutungen bis hin zu starken Blutungen mit Blutklumpen variieren. Es ist aber wichtig zu wissen, dass leichte Blutungen, besonders in der Frühschwangerschaft, auch bei intakten Schwangerschaften vorkommen können.
Weitere Symptome können krampfartige Unterbauchschmerzen oder Schmerzen ähnlich der Menstruation sein. Auch Wehen können auftreten, da der Körper versucht, das Schwangerschaftsgewebe aus der Gebärmutter auszustossen.
In späteren Stadien kann es zu einem Nachlassen oder Ausbleiben der Kindsbewegungen kommen. Zudem kann ein Rückgang typischer Schwangerschaftsanzeichen wie Übelkeit oder Spannungsgefühl in den Brüsten ein Hinweis sein.
Die Rolle des Schwangerschaftshormons hCG
Ein wichtiger Faktor bei der Bestätigung und dem Verlauf einer Schwangerschaft ist das humane Choriongonadotropin (hCG). Dieses Hormon wird von der Plazenta produziert und ist für die Aufrechterhaltung der Schwangerschaft in den frühen Phasen entscheidend.
- Frühe Schwangerschaft: In den ersten Wochen einer gesunden Schwangerschaft verdoppeln sich die hCG-Werte etwa alle 48 bis 72 Stunden. Ein langsamer Anstieg oder ein Abfall der hCG-Werte kann ein Hinweis auf eine mögliche Fehlgeburt sein.
- Symptome und hCG: Wenn typische Schwangerschaftsbeschwerden wie Übelkeit nachlassen, kann dies mit einem sinkenden hCG-Spiegel zusammenhängen.
- Diagnose: Bei Verdacht auf eine Fehlgeburt kann der hCG-Wert im Blut gemessen werden. Wiederholte Messungen (serielle hCG-Messungen) geben Ärzten wichtige Informationen über den Verlauf der Schwangerschaft. Ein niedriger oder sinkender hCG-Spiegel in Verbindung mit anderen Symptomen und Ultraschallbefunden kann die Diagnose einer Fehlgeburt bestätigen.
- Verhaltene Fehlgeburt: Manchmal kommt es zu einer Fehlgeburt ohne Blutungen. In solchen Fällen kann ein niedriger hCG-Wert in Verbindung mit einer Ultraschalluntersuchung, die keine Herzaktivität zeigt, auf einen sogenannten verhaltenen Abort hindeuten.
- Nach der Fehlgeburt: Nach einer Fehlgeburt sinken die hCG-Werte wieder auf den Normalwert ab. Dies kann einige Tage bis zu mehreren Wochen dauern, abhängig davon, wie weit die Schwangerschaft fortgeschritten war.
Die Ultraschalluntersuchung
Die Ultraschalluntersuchung ist ein zentrales Diagnoseverfahren bei Verdacht auf eine Fehlgeburt. Ab der 5. bis 6. Schwangerschaftswoche sollte eine Fruchthöhle sichtbar sein, und in den darauffolgenden Wochen ein Embryo mit nachweisbarem Herzschlag. Bleibt der Herzschlag bei einem Embryo ab einer bestimmten Grösse aus oder ist die Fruchthöhle leer, kann dies auf eine Fehlgeburt hindeuten.
Da sich Embryonalentwicklung und Sichtbarkeit individuell unterscheiden können, sind oft wiederholte Ultraschalluntersuchungen erforderlich, um die Diagnose mit Sicherheit zu stellen.
Formen der Fehlgeburt
Fehlgeburten verlaufen sehr unterschiedlich und werden nicht immer sofort bemerkt. Während manche Frauen typische Anzeichen wie Abgang von Blutklumpen oder krampfartige Schmerzen wahrnehmen, wird eine Fehlgeburt in anderen Fällen erst bei einer Ultraschalluntersuchung festgestellt. Auch der Verlauf kann variieren – in manchen Fällen stösst der Körper das Schwangerschaftsgewebe von selbst aus, in anderen bleibt es in der Gebärmutter zurück.
- Drohende Fehlgeburt (Abortus imminens): Blutungen bei geschlossenem Muttermund und nachweisbarer Herzaktion.
- Beginnende Fehlgeburt (Abortus incipiens/Drohender Abort): Blutungen und Schmerzen bei geöffnetem Muttermund.
- Spontanabort: Allgemeiner Begriff für eine natürlich eintretende Fehlgeburt.
- Frühabort: Fehlgeburt vor der 12. Schwangerschaftswoche.
- Spätabort: Fehlgeburt zwischen der 12. und 24. Schwangerschaftswoche.
- Verhaltene Fehlgeburt (Missed Abortion): Abgestorbener Fötus verbleibt ohne Symptome in der Gebärmutter.
- Vollständige Fehlgeburt (Abortus completus): Das gesamte Schwangerschaftsgewebe wurde ausgestossen.
- Unvollständige Fehlgeburt (Abortus incompletus): Teile des Schwangerschaftsgewebes verbleiben in der Gebärmutter.
- Abortivei/Windei: Leere Fruchthöhle ohne Embryo.
Medizinische Massnahmen nach einer Fehlgeburt: Was nun?
Nach einer Fehlgeburt, insbesondere wenn diese unvollständig ist oder es sich um eine verhaltene Fehlgeburt handelt, kann ein medizinischer Eingriff notwendig sein, um verbliebenes Schwangerschaftsgewebe aus der Gebärmutter zu entfernen und Infektionen oder starke Blutungen zu verhindern.
Hierfür gibt es zwei gängige Methoden: die Absaugung (Vakuumaspiration) und die Ausschabung (Kürettage). Die Absaugung gilt als die schonendere und oft bevorzugte Methode, da sie mit einem geringeren Risiko für Verletzungen der Gebärmutter verbunden ist. Dabei wird das Gewebe sanft durch ein dünnes Röhrchen entfernt. Die Ausschabung erfolgt hingegen mithilfe einer Kürette, mit der das Gewebe manuell gelöst wird. Beide Eingriffe werden in der Regel unter Vollnarkose durchgeführt und sind meist ambulante Routineeingriffe.
Nach dem Eingriff ist es wichtig, sich zu schonen und für einige Wochen auf Tampons, Bäder und Geschlechtsverkehr zu verzichten, um Infektionen vorzubeugen. Leichte Blutungen oder Ausfluss sind in den ersten Tagen normal, und die nächste Menstruationsblutung setzt in der Regel innerhalb von 4 bis 8 Wochen wieder ein.
Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass ein solcher Eingriff nicht immer notwendig ist. In manchen Fällen, insbesondere in der Frühschwangerschaft, kann es möglich sein, auf einen spontanen Abgang des Schwangerschaftsgewebes zu warten (expectative Therapie). Alternativ kann auch die Gabe von Medikamenten (z. B. Misoprostol) in Betracht gezogen werden, um den Körper beim Ausstossen der Gebärmutterschleimhaut und des Gewebes zu unterstützen (medikamentöser Abbruch).
Welche Vorgehensweise am besten geeignet ist, hängt vom Schwangerschaftsalter, der Art der Fehlgeburt und den individuellen Wünschen der Frau ab und sollte ausführlich mit dem behandelnden Frauenarzt besprochen werden.
Unterstützung und Perspektiven für die nächste Schwangerschaft
Eine Fehlgeburt ist für betroffene Paare ein einschneidendes Erlebnis. Es ist wichtig, dass ihr euch Zeit nehmt, zu trauern, und euch emotionale Unterstützung von Familie oder Freunden sucht oder eine professionelle Therapie in Anspruch nehmt. Unterstützungsgruppen, Therapeuten oder Beratungsstellen können bei der Verarbeitung des Verlusts helfen. Auch Hebammen können nach einer Fehlgeburt wichtige Unterstützung leisten. Da das Thema Fehlgeburt oft ein Tabuthema ist, ist es wichtig, offen darüber zu sprechen.

Wann kann ich nach einer Fehlgeburt wieder schwanger werden?
Körperlich gesehen ist es nach einer frühen und unkomplizierten Fehlgeburt oft möglich, relativ bald wieder zu versuchen, schwanger zu werden. Aus medizinischer Sicht wird jedoch empfohlen, mindestens eine normale Menstruationsblutung abzuwarten, damit sich der Hormonhaushalt wieder regulieren kann.
Nach späteren Fehlgeburten oder einer Ausschabung kann es ratsam sein, einige Monate (z.B. 3 oder 6 Monate gemäss WHO-Empfehlung) zu warten. Entscheidend ist jedoch auch die emotionale Bereitschaft für eine erneute Schwangerschaft.
Wie kann mich Ängsten vor einer erneuten Fehlgeburt umgehen?
Ängste vor einer erneuten Fehlgeburt sind in einer Folgeschwangerschaft normal. Es ist beruhigend zu wissen, dass die Mehrheit der Frauen, die eine Fehlgeburt erlebt haben, in Zukunft eine gesunde Schwangerschaft haben. Strategien zum Umgang mit Ängsten wie Achtsamkeitsübungen, Meditation, der Austausch in Selbsthilfegruppen oder Gespräche mit einem Therapeuten oder dem Partner können hilfreich sein. Es ist wichtig, das Tabuthema Fehlgeburt zu durchbrechen und offen über die eigenen Erfahrungen zu sprechen.
Regelmässige Kontrollen beim Frauenarzt sind nach einer Fehlgeburt und bei der Planung einer erneuten Schwangerschaft unerlässlich. Paaren mit wiederholten Fehlgeburten wird möglicherweise eine weiterführende Diagnostik und spezialisierte Betreuung empfohlen.
Fazit: Frühzeitige Diagnostik kann das Fehlgeburtsrisiko senken
Eine Fehlgeburt ist eine belastende Erfahrung, doch durch eine frühzeitige und gezielte Diagnostik lassen sich mögliche Risikofaktoren erkennen und in vielen Fällen minimieren.
Moderne Untersuchungsmethoden helfen dabei, hormonelle, genetische oder immunologische Ursachen frühzeitig zu identifizieren und entsprechende Behandlungen einzuleiten.
In unserer Kinderwunschklinik in Zürich bieten wir dir gezielte medizinische Betreuung und individuelle Diagnostik, um deine Chancen auf eine erfolgreiche Schwangerschaft deutlich erhöhen. Vereinbare ganz einfach deinen Termin für ein Gespräch mit unseren Experten.
Häufig gestellte Fragen zum Fehlgeburtsrisiko
In welcher Woche kommt es am häufigsten zu Fehlgeburten?
Die meisten Fehlgeburten treten in den ersten 12 Schwangerschaftswochen auf, insbesondere in den ersten 8 Wochen. Etwa 80 % aller Fehlgeburten sind Frühaborte, die häufig auf chromosomale Anomalien, hormonelle Ungleichgewichte oder andere medizinische Ursachen zurückzuführen sind.
In welcher Schwangerschaftswoche (SSW) sinkt das Fehlgeburtsrisiko?
Das Fehlgeburtsrisiko ist in den ersten Wochen der Schwangerschaft am höchsten und sinkt ab der 12. Schwangerschaftswoche deutlich. Nach der 14. Woche tritt eine Fehlgeburt nur noch selten auf. Sobald der Fötus die 24. Woche erreicht hat, spricht man nicht mehr von einer Fehlgeburt, sondern von einer Frühgeburt, da das Kind ausserhalb des Mutterleibs überlebensfähig sein kann.
Kann man eine Fehlgeburt im Ultraschall erkennen?
Ja, eine Fehlgeburt kann im Ultraschall sichtbar werden. Anzeichen können eine leere Fruchthöhle, ein fehlender Herzschlag oder ein Wachstumsstillstand des Embryos sein. In manchen Fällen sind wiederholte Ultraschalluntersuchungen erforderlich, um eine sichere Diagnose zu stellen, insbesondere wenn die Schwangerschaft noch sehr früh ist.
Wie kann ich mein Fehlgeburtsrisiko senken?
Wie kann ich mein Fehlgeburtsrisiko senken?
Es gibt einige Massnahmen, die du ergreifen kannst, um deine Chancen auf eine gesunde Schwangerschaft zu erhöhen. Dennoch ist es wichtig zu wissen, dass die meisten Fehlgeburten genetisch bedingt sind und sich nicht vermeiden lassen. Chromosomale Anomalien beim Embryo sind der häufigste Grund für eine Fehlgeburt und treten meist zufällig auf. Diese können durch Lebensstilfaktoren oder medizinische Massnahmen nicht beeinflusst werden.
Trotzdem kannst du Folgendes tun, um dein Risiko zu senken:
- Gesunde Lebensweise: Achte auf einen gesunden Lebensstil, ausreichend Bewegung und genügend Schlaf. Vermeide Rauchen, Alkohol und Drogen.
- Gewicht im gesunden Bereich halten: Ein gesundes Körpergewicht unterstützt den Schwangerschaftsverlauf und verringert das Risiko für Komplikationen.
- Stress vermeiden: Chronischer Stress kann das Fehlgeburtsrisiko erhöhen. Entspannungsübungen wie Yoga, Meditation und ausreichend Ruhe können helfen, den Stresslevel zu senken.
- Frühzeitige ärztliche Betreuung: Regelmässige ärztliche Untersuchungen vor und während der Schwangerschaft helfen, gesundheitliche Probleme frühzeitig zu erkennen und zu behandeln.
- Vorsorgeuntersuchungen: Bluttests, Ultraschalluntersuchungen und gegebenenfalls genetische Tests können helfen, Risiken frühzeitig zu identifizieren, auch wenn sie keine Fehlgeburt verhindern können.
- Behandlung von Vorerkrankungen: Erkrankungen wie Diabetes mellitus oder Schilddrüsenprobleme solltest du vor und während der Schwangerschaft kontrollieren und behandeln lassen.
- Vermeidung von Umweltgiften: Reduziere den Kontakt mit schädlichen Chemikalien und anderen Umweltfaktoren, die das Fehlgeburtsrisiko erhöhen könnten.