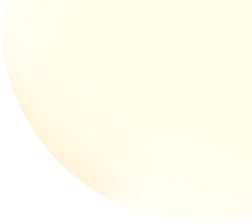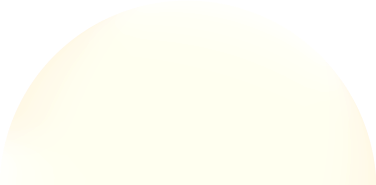Erfahre, warum sich ein Embryo manchmal nicht einnistet und welche Ursachen hinter einem Implantationsversagen stecken können.
Alles Wichtige über Implantationsversagen
- Von Implantationsversagen spricht man, wenn sich der Embryo nach wiederholten Embryotransfers nicht einnistet.
- Ein wiederholtes Implantationsversagen (RIF) wird diagnostiziert, wenn nach mindestens drei Transfers mit guten Embryonen keine Schwangerschaft eintritt.
- Etwa bis zu 10 % der IVF-Patientinnen sind betroffen.
- Gründe können genetische Veränderungen, Anomalien der Gebärmutter, Immunstörungen oder Gerinnungsprobleme.
- Viele Paare werden schwanger, sobald die Ursachen erkannt und behandelt werden.
Was tun, wenn sich der Embryo nicht einnistet?
Für viele Paare, die sich ein Kind wünschen und den Weg der künstlichen Befruchtung (IVF) gehen, ist das Ausbleiben einer Schwangerschaft trotz vielversprechender Embryonen ein emotionaler Tiefschlag.
Noch belastender wird es, wenn sich dieser Moment wiederholt – sei es durch ein Implantationsversagen, bei dem sich der Embryo gar nicht erst einnistet, oder durch wiederholte Fehlgeburten, bei denen eine begonnene Schwangerschaft nicht bestehen bleibt.
Beide Situationen sind medizinisch komplex und emotional herausfordernd. Sie werfen viele Fragen auf: Warum klappt es nicht, obwohl alles „gut aussieht“? Was steckt dahinter? Und was kann man tun? All dies erfährst du in diesem Artikel.

Woran erkennt man ein Implantationsversagen?
Von einem Implantationsversagen spricht man, wenn sich trotz wiederholter Übertragung von Embryonen keine Einnistung nachweisen lässt – also weder ein Anstieg des hCG-Werts noch eine frühe Schwangerschaft.
In der Regel sprechen Ärzt:innen von einem wiederholten Implantationsversagen, wenn nach mindestens drei Transfers mit guten Embryonen keine Schwangerschaft entsteht.
Wie häufig ist Implantationsversagen?
Wie oft ein Implantationsversagen nach einer IVF auftritt, lässt sich nicht exakt beziffern. In der Regel sprechen Fachleute dann davon, wenn sich trotz wiederholter Übertragung qualitativ guter Embryonen keine Schwangerschaft einstellt.
Laut einer Übersichtsarbeit liegt die Inzidenz eines wiederholten Implantationsversagens (RIF) – definiert als drei oder mehr erfolglose Embryotransfers – bei bis zu etwa 10 % der IVF-Patientinnen.
Eine weitere Studie zeigte, dass die Implantationsrate bei Frauen mit drei oder mehr fehlgeschlagenen Transfers auf rund 21 % sank, während sie bei Patientinnen ohne vorherige Fehlversuche etwa 46 % betrug.
Bei genauer genetischer Analyse der Embryonen (sogenannte euploide Embryonen, also chromosomal unauffällige) liegt die Rate echter, ungeklärter Einnistungsstörungen laut einer Studie sogar bei unter 5 %.

Was kann eine Einnistung verhindern?
Die Ursachen sind vielfältig – von genetischen Faktoren über die Beschaffenheit der Gebärmutter bis hin zu immunologischen oder gerinnungsbedingten Störungen. Umso wichtiger sind umfassende Untersuchungen verbunden mit einer individuellen, gründlichen Diagnostik, die nicht nur medizinische Fakten berücksichtigt, sondern auch die persönliche Geschichte und Belastung der Betroffenen.
- Embryonale Ursachen: Auch wenn Embryonen unter dem Mikroskop gut aussehen, können genetische Defekte vorliegen. Besonders relevant sind sogenannte balancierte chromosomale Translokationen – also Umbauten im Erbgut, bei denen genetisches Material zwischen zwei Chromosomen vertauscht wurde, ohne dass dabei Erbinformation verloren geht. Studien zeigen, dass etwa 1–3 % der Paare mit wiederholtem Schwangerschaftsverlust Träger:innen einer balancierten Translokation sind.
- Gebärmutterfaktoren: Die Gebärmutterschleimhaut (Endometrium) muss optimal vorbereitet sein. Myome, Polypen oder eine sogenannte septierte Gebärmutter (Gebärmutter mit einer Trennwand) können die Einnistung behindern. Eine Studie von Coughlan et al. (2014) empfiehlt die Hysteroskopie als Goldstandard zur Abklärung.
- Immunologische Einflüsse: Das Immunsystem spielt eine zentrale Rolle. Eine Überaktivität von natürlichen Killerzellen oder das Vorhandensein von Antiphospholipid-Antikörpern kann die Einnistung stören. Die Relevanz immunologischer Diagnostik wird zunehmend anerkannt, auch wenn die Studienlage noch nicht einheitlich ist.
- Gerinnungsstörungen: Eine Thrombophilie kann die Durchblutung der Gebärmutter beeinträchtigen. Mutationen wie Faktor-V-Leiden oder Protein-C/S-Mangel sind bei Frauen mit wiederholten Fehlgeburten häufiger nachweisbar.
Eine Übersicht zu möglichen Gründen für eine Einnistungsstörung erhältst du im Video von Dr. med. Heidi Gößlinghoff:
Welche Untersuchungen sind bei Implantationsversagen sinnvoll?
Wenn nach mehreren IVF-Versuchen keine Schwangerschaft eintritt, sollte eine umfassende Diagnostik erfolgen:
- Ultraschall und Hysteroskopie zur Beurteilung der Gebärmutterstruktur und anatomische Anomalien
- Immunologische Untersuchungen (z. B. NK-Zellen, Antikörperprofile)
- Gerinnungsdiagnostik (Untersuchung auf Thrombophilien)
- Genetische Analyse beider Partner
- Bewertung des Embryotransfers durch erfahrene Reproduktionsmediziner
Diese Schritte helfen, die Ursachen gezielt zu identifizieren und passende Therapien zu entwickeln.
Wenn du mehr darüber wissen willst, warum du trotz optimaler Voraussetzungen einfach nicht schwanger wird, empfehlen wir dir diesen Podcast mit Dr. Elena Leineweber:
Therapieansätze: individuell statt pauschal
Da die Ursachen für Implantationsversagen vielfältig sein können, richtet sich die Behandlung nach den Befunden. Mögliche Therapieansätze können sein:
- Operative Korrektur von Gebärmutteranomalien
- Hormonelle Unterstützung des Endometriums
- Immunmodulatorische Therapien (z. B. Kortison, Intralipid)
- Gerinnungshemmende Medikamente bei Thrombophilie
Studien zeigen, dass eine gezielte Diagnostik und individuell abgestimmte Behandlung die Chancen auf eine Schwangerschaft nach Implantationsversagen erhöhen können. Besonders ermutigend: Viele Paare werden schwanger, sobald die medizinischen Ursachen erkannt und gezielt behandelt werden.
Gleichzeitig legen Befunde nahe, dass psychologische Begleitung und soziale Unterstützung für die Patient:innen nicht nur das emotionale Erleben steigern, sondern potenziell auch das Behandlungsergebnis beeinflussen. Dennoch sei erwähnt, dass die Evidenzlage für einzelne Interventionen noch begrenzt ist.

Fazit: Umfassende Diagnostik schafft Klarheit
Implantationsversagen ist kein endgültiges Urteil, sondern ein Hinweis darauf, dass noch nicht alle Einflussfaktoren erkannt sind. Eine gründliche Diagnostik, kombiniert mit gezielten Therapieansätzen und psychologischer Unterstützung, kann die Erfolgsrate erheblich steigern.
Aktuelle Studien belegen, dass Paare, die medizinisch wie emotional umfassend begleitet werden, langfristig bessere Chancen auf eine Schwangerschaft haben.
In unserer Kinderwunschklinik in Zürich arbeiten wir interdisziplinär, um die Ursachen individuell zu erkennen und zu behandeln – mit modernster Technik, Erfahrung und einem offenen Ohr für deine Geschichte.
Häufig gestellte Fragen zu Implantationsversagen
Was ist eine biochemische Schwangerschaft?
Im Gegensatz zum Implantationsversagen, bezeichnet eine biochemische Schwangerschaft eine sehr frühe Form der Schwangerschaft, bei der sich der Embryo zwar kurzzeitig einnistet, die Entwicklung aber schon nach wenigen Tagen stoppt – bevor die Schwangerschaft im Ultraschall sichtbar wird.
Das bedeutet: Der Schwangerschaftstest fällt zunächst positiv aus, doch nach kurzer Zeit sinkt der Wert wieder, und die Periode setzt meist nur leicht verspätet ein.
Typische Anzeichen sind:
- ein anfänglich positiver Schwangerschaftstest,
- gefolgt von einer Blutung wenige Tage später,
- und ein abfallender hCG-Wert im Blut.
Für viele Betroffene ist das besonders frustrierend, weil die Hoffnung auf eine erfolgreiche Einnistung kurz aufblitzt – nur um gleich wieder enttäuscht zu werden.
Medizinisch gesehen liegt hier keine stabile Einnistung vor; deshalb wird die biochemische Schwangerschaft häufig als „früher Implantationsverlust“ eingeordnet.
Kann man Implantationsversagen mit PID vorbeugen?
Bei wiederholtem Implantationsversagen stellt sich oft die Frage, ob genetisch bedingte Embryonenfehler dahinterstecken. Aneuploide Embryonen können sich meist nicht einnisten oder führen früh zu einer Fehlgeburt.
Mit der Präimplantationsdiagnostik (PGT-A oder PID) lässt sich bereits vor dem Embryotransfer prüfen, ob ein Embryo eine normale Chromosomenzahl aufweist. Dazu wird am fünften Entwicklungstag (Blastozystenstadium) eine winzige Zellprobe entnommen und genetisch analysiert. Nur Embryonen mit unauffälligem Chromosomensatz werden anschliessend transferiert.
Studien zeigen, dass der Einsatz von PGT-A vor allem bei:
- Frauen über 35 Jahren,
- wiederholtem Implantationsversagen,
- Fehlgeburten in der Vorgeschichte, oder
- auffälliger Chromosomenanalyse bei den Eltern
die Chancen auf eine Schwangerschaft deutlich verbessern und das Risiko weiterer Fehlversuche reduzieren kann.
Allerdings kann PGT-A kein „echtes“ Implantationsversagen vollständig verhindern, wenn die Ursache nicht im Embryo, sondern z. B. in der Gebärmutterschleimhaut oder im Immunsystem liegt. Es hilft aber, genetisch bedingte Einnistungsprobleme auszuschliessen und die Behandlungsstrategie gezielter zu planen.