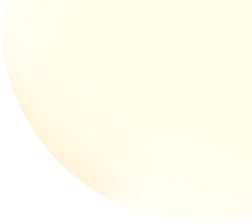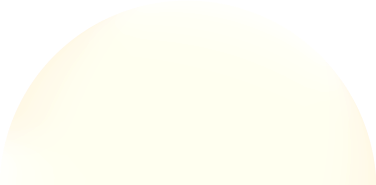Unerfüllter Kinderwunsch? Erfahre, welche Rolle die Immunologie bei Fehlgeburten oder Implantationsversagen spielen kann. Mehr erfahren.
Immunologische Faktoren bei unerfülltem Kinderwunsch
Die Reproduktionsimmunologie erforscht, wie das Immunsystem die Fruchtbarkeit beeinflusst. Bei schätzungsweise 10–15 % der Paare mit unerfülltem Kinderwunsch spielen dabei immunologische Faktoren eine Rolle.
Eigentlich schützt uns das Immunsystem vor Krankheitserregern. Manchmal greift es jedoch fehl und erkennt Eizellen, Spermien oder den Embryo als körperfremde Zellen. Dadurch kann es die Einnistung verhindern oder zu Fehlgeburten führen.
Die immunologische Diagnostik hilft, solche verborgenen Ursachen zu erkennen und gezielt zu behandeln, um die Chancen auf eine erfolgreiche Schwangerschaft zu verbessern.

Wie häufig sind immunologische Ursachen?
Studien zeigen, dass Antisperm-Antikörper (ASA) – also Abwehrstoffe gegen Spermien – bei etwa 2–7 % der Männer mit eingeschränkter Fruchtbarkeit vorkommen können. Manche Quellen nennen bis zu rund 12 % der betroffenen Paare.
Wie gross der Anteil immunologischer Ursachen insgesamt ist, lässt sich bisher jedoch nicht genau sagen – Fachgesellschaften wie die ESHRE empfehlen daher derzeit keine Routinetests, solange keine konkreten Hinweise vorliegen.
So beeinflusst das Immunsystem Fruchtbarkeit und Einnistung
Die immunologische Herausforderung der Schwangerschaft
Eine Schwangerschaft stellt das mütterliche Immunsystem vor eine besondere Aufgabe: Der Embryo trägt zur Hälfte väterliche Gene und ist damit immunologisch gesehen ein „Fremdkörper“. Dennoch muss das Immunsystem ihn tolerieren und sogar aktiv unterstützen, damit sich die befruchtete Eizelle erfolgreich in der Gebärmutterschleimhaut einnisten kann.
Damit das gelingt, braucht es ein fein abgestimmtes Zusammenspiel verschiedener Immunzellen und Botenstoffe:
- Natürliche Killerzellen (NK-Zellen) machen im Endometrium bis zu 70 % der Immunzellen aus. Sie fördern die Entwicklung der Plazenta und unterstützen die Durchblutung der Gebärmutterschleimhaut.
- Regulatorische T-Zellen (Tregs) sorgen dafür, dass überschiessende Abwehrreaktionen gedämpft werden und der Körper den Embryo nicht als Fremdkörper abstösst. Studien zeigen, dass Frauen mit wiederholten Fehlgeburten häufig verringerte Treg-Anteile oder eine eingeschränkte Funktion dieser Zellen aufweisen.
- Antikörper und Zytokine (Botenstoffe des Immunsystems) helfen, die Kommunikation zwischen Immunzellen, Gebärmutterschleimhaut und Embryo zu steuern. Ein ausgewogenes Verhältnis von entzündungsfördernden und entzündungshemmenden Zytokinen ist entscheidend für eine erfolgreiche Einnistung.
Mehr über den Zusammenhang zwischen Immunsystem und Kinderwunsch erfährst du in diesem Video:
Störungen im immunologischen Gleichgewicht
Wenn dieses Gleichgewicht gestört ist, kann das die Fruchtbarkeit beeinträchtigen:
- Autoimmunologische Faktoren: Das Immunsystem greift körpereigene Strukturen an – etwa Spermien, Eizellen oder das Schwangerschaftsgewebe. Studien zeigen, dass sogenannte Antisperm-Antikörper (ASA) bei etwa 9–12 % der ungewollt kinderlosen Paare als möglicher Einflussfaktor gelten.
- Alloimmunologische Faktoren: Hier reagiert das Immunsystem der Frau auf Zellen oder Strukturen des Embryos. Das kann die Einnistung erschweren oder Fehlgeburten begünstigen.
Mögliche Ursache sind beispielsweise:
- Chronische Endometritis, die bei Frauen mit wiederholtem Implantationsversagen in Studien in etwa 14–67 % der Fälle nachgewiesen wird.
- Schilddrüsen-Autoimmunität, die bei 13–20 % der ungewollt kinderlosen Frauen vorkommt.
- Antiphospholipid-Antikörper, die bei Frauen mit wiederholten Fehlgeburten – je nach Studie und Testkriterien – in 1–25 % der Fälle nachweisbar sind.
Eine genaue Gesamtquote immunologischer Ursachen lässt sich bislang nicht sicher angeben. Klar ist jedoch, dass solche Störungen häufig bei wiederholtem Implantationsversagen, habituellen Fehlgeburten oder unerklärter Unfruchtbarkeit eine Rolle spielen können.
Diagnostikverfahren in der Reproduktionsimmunologie
Wenn eine Schwangerschaft trotz guter Voraussetzungen immer wieder ausbleibt, kann eine gezielte immunologische Abklärung helfen, bisher unerkannte Ursachen zu erkennen. Dabei werden verschiedene Labor- und Gewebeuntersuchungen kombiniert, um ein individuelles Bild des Immunsystems zu erhalten – und die Behandlung gezielt darauf abzustimmen.
NK-Zellen-Diagnostik
Natürliche Killerzellen (NK-Zellen) übernehmen wichtige Aufgaben bei der Einnistung und frühen Schwangerschaft. Sind sie jedoch zu aktiv oder in erhöhter Zahl vorhanden, kann das den Aufbau der Gebärmutterschleimhaut (Endometrium) stören.
Eine Blutuntersuchung oder Gewebeprobe aus dem Endometrium zeigt, ob ein Ungleichgewicht besteht. Dabei werden unter anderem die Anzahl der NK-Zellen (normaler NK-Anteil liegt unter 12–15 %) und ihre Aktivität (z. B. über den Marker CD69+) bestimmt.
Autoantikörper-Screening
Bei manchen Frauen greift das Immunsystem irrtümlich körpereigene Strukturen an – sogenannte Autoantikörper können dann die Fruchtbarkeit beeinflussen und zu einer Autoimmunerkrankung führen. Ein Bluttest prüft, ob solche Antikörper vorliegen, zum Beispiel:
- Antiphospholipid-Antikörper, die mit Gerinnungsstörungen und Einnistungsproblemen verbunden sein können
- Schilddrüsen-Antikörper (Anti-TPO, Anti-Thyreoglobulin), die eine Schwangerschaft erschweren können
- Antinukleäre Antikörper (ANA), die auf eine allgemeine Autoimmunreaktion hindeuten

Thrombophilie-Diagnostik
Auch Gerinnungsstörungen können die Durchblutung der Gebärmutterschleimhaut beeinträchtigen und damit die Einnistung erschweren. Eine einfache Blutuntersuchung kann zeigen, ob genetische Veränderungen wie die Faktor-V-Leiden-Mutation, eine Prothrombin-Mutation oder ein Protein-C- bzw. Protein-S-Mangel vorliegen. Auch MTHFR-Mutationen werden in diesem Zusammenhang überprüft.
KIR-HLA-C-Genotypisierung
Manchmal liegt die Ursache in der genetischen Kombination zwischen Mutter und Embryo.
Die KIR-HLA-C-Typisierung untersucht, wie die Immunrezeptoren (KIR) der Mutter mit den HLA-C-Merkmalen des Embryos interagieren. Diese Kombination kann Einfluss darauf haben, ob sich die befruchtete Eizelle erfolgreich einnistet.
Die Analyse beider Partner hilft, mögliche Immuninkompatibilitäten zu erkennen und die Therapie individuell abzustimmen.
Mehr über KIR-Gene erfährst du auch in diesem Podcast:
Chronische Endometritis
Eine chronische Entzündung der Gebärmutterschleimhaut verläuft oft unbemerkt, kann aber die Einnistung erheblich stören. Zur sicheren Diagnose werden meist eine Hysteroskopie mit Gewebeentnahme, eine CD138-Immunfärbung zum Nachweis von Plasmazellen sowie eine Analyse des endometrialen Mikrobioms durchgeführt.
Therapieansätze in der Reproduktionsimmunologie
Welche Behandlung infrage kommt, hängt immer von den individuellen Befunden ab. Ziel der Therapie ist es, das Immunsystem zu regulieren und optimale Bedingungen für die Einnistung zu schaffen.
Immunmodulatorische Ansätze
Je nach Diagnose können unterschiedliche Behandlungsformen in Betracht gezogen werden:
- Kortikoide (z. B. Prednisolon): können übermässige Immunreaktionen dämpfen und so die Einnistung unterstützen.
- Intravenöse Immunglobuline (IVIG): werden in Einzelfällen eingesetzt, um das Immunsystem zu modulieren, insbesondere bei nachgewiesenen Autoimmunreaktionen.
- Intralipid-Infusionen: werden zur Senkung der NK-Zell-Aktivität diskutiert. Die Studienlage hierzu ist derzeit noch uneinheitlich, weshalb diese Therapie nicht routinemässig empfohlen wird.
Neuere Forschung zeigt, dass Östrogen die Aktivität der natürlichen Killerzellen (NK-Zellen) beeinflusst. Bei Endometriose scheint dieses Zusammenspiel jedoch aus dem Gleichgewicht zu geraten: Zu hohe oder fehlgesteuerte Östrogenspiegel können die Funktion der NK-Zellen verändern und dadurch die Einnistung einer befruchteten Eizelle erschweren. Diese Erkenntnisse könnten künftig helfen, gezieltere Therapien zu entwickeln, die das hormonelle und immunologische Gleichgewicht wiederherstellen.
Behandlung von Gerinnungsstörungen
Wenn Blutgerinnungsstörungen nachgewiesen werden, können Medikamente helfen, die Durchblutung der Gebärmutterschleimhaut zu verbessern. Dazu zählen:
- Niedermolekulare Heparine
- Acetylsalicylsäure (ASS) in niedriger Dosierung
- Folsäure-Supplementierung bei bestimmten genetischen Varianten (z. B. MTHFR-Mutationen)
Behandlung einer chronischen Endometritis
Wird eine chronische Entzündung der Gebärmutterschleimhaut festgestellt, erfolgt in der Regel eine gezielte antibiotische Therapie, z. B. mit Doxycyclin (10–14 Tage). Bei Resistenzen können andere Präparate wie Ciprofloxacin eingesetzt werden.
Ergänzend kann eine probiotische Therapie helfen, das natürliche Gleichgewicht des Endometriums wiederherzustellen.
So zeigte eine Übersichtsarbeit, dass sich nach einer antibiotischen Therapie die Schwangerschafts- und Lebendgeburtenraten signifikant erhöhen können. Ebenfalls wurden nach erfolgreicher Behandlung bessere Ergebnisse nach einer Kinderwunschbehandlung beobachtet.
Wie kann ich eine immunologische Diagnostik durchführen?
Die immunologische Diagnostik gehört nicht zur Standardabklärung bei unerfülltem Kinderwunsch. Sie wird vor allem dann eingesetzt, wenn nach mehreren Behandlungsversuchen keine eindeutige Ursache gefunden wurde oder Hinweise auf Autoimmunprozesse oder Entzündungen bestehen.
Die Studienlage ist bisher noch uneinheitlich ist. Entsprechend gelten viele immunologische Tests und Therapien derzeit als ergänzend, jedoch nicht als routinemässig empfohlen.
Wann eine immunologische Abklärung sinnvoll sein kann
Eine weiterführende Diagnostik kann hilfreich sein, wenn:
- nach mehreren erfolglosen Embryotransfers (≥ 3) keine Ursache gefunden wurde,
- mehrere Fehlgeburten (≥ 2–3) ohne erkennbaren Grund aufgetreten sind,
- eine unerklärte Infertilität besteht, trotz unauffälliger Standardbefunde,
- Autoimmunerkrankungen bekannt sind oder familiär gehäuft vorkommen,
- Hinweise auf Gerinnungsstörungen (Thrombophilien) bestehen.
Wie die Diagnostik in der Praxis abläuft
Die Abklärung erfolgt in der Regel stufenweise. In Kinderwunschkliniken werden – je nach individueller Situation – verschiedene Bluttests zur Abklärung immunologischer Faktoren angeboten. Häufig zählen dazu Autoantikörpertests (z. B. gegen Schilddrüsen- oder Gerinnungsproteine), die mögliche Autoimmunprozesse aufdecken können.
Einige spezialisierte Zentren bieten zudem NK-Zell-Analysen im Blut oder im Gebärmuttergewebe an, oft in Zusammenarbeit mit externen Fachlaboren. Diese Untersuchungen gelten jedoch nicht als Routineverfahren, da die wissenschaftliche Bewertung und Vergleichbarkeit der Ergebnisse derzeit noch eingeschränkt ist
Wenn sich dabei Auffälligkeiten zeigen oder der Verdacht auf immunologische Störungen besteht, kann die Diagnostik erweitert werden, z. B. durch:
- eine Endometriumbiopsie mit CD138-Nachweis bei Verdacht auf eine chronische Endometritis,
- eine KIR-/HLA-C-Genotypisierung beider Partner zur Beurteilung genetischer Immunfaktoren,
- die Analyse von Zytokin- und Immunprofilen im Endometrium.

Ein Kinderwunschzentrum wie unsere Cada Klinik in Zürich ist dabei die erste Anlaufstelle: Sie kann sowohl die Basisdiagnostik durchführen als auch den Bedarf für weiterführende Tests individuell einschätzen. So lassen sich Ergebnisse fachgerecht bewerten und mögliche Behandlungsoptionen gezielt besprechen.
Fazit: Immunologische Diagnostik als Baustein moderner Kinderwunschmedizin
Die immunologische Diagnostik hat sich in den letzten Jahren von einer Nischenforschung zu einem wichtigen Ergänzungsbaustein der Kinderwunschmedizin entwickelt.
Sie kann helfen, bislang verborgene Ursachen für unerklärte Infertilität, wiederholtes Implantationsversagen oder mehrfache Fehlgeburten aufzudecken – insbesondere dann, wenn alle Standarduntersuchungen unauffällig geblieben sind.
Auch wenn die wissenschaftliche Bewertung einzelner Tests noch nicht in allen Bereichen einheitlich ist, zeigen aktuelle Studien und klinische Erfahrungen, dass die Berücksichtigung immunologischer Faktoren in vielen Fällen den entscheidenden Unterschied machen kann.
Da es sich um ein komplexes und spezialisiertes Gebiet handelt, ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Reproduktionsmedizinern, Immunologen und Laborexperten entscheidend. In erfahrenen Kinderwunschzentren kann individuell geprüft werden, welche Untersuchungen wirklich sinnvoll sind und welche nicht.
Bei der Cada Kinderwunschklinik Zürich begleiten wir dich mit medizinischer Expertise und Einfühlungsvermögen auf deinem Weg zum Wunschkind.